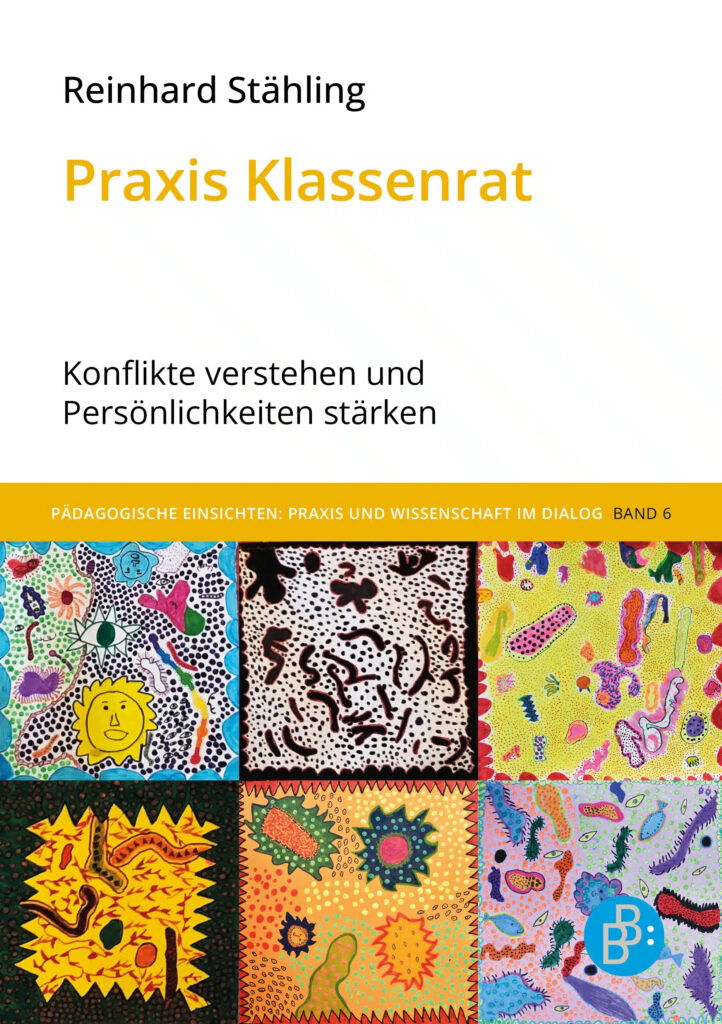
Reinhard Stähling
Praxis Klassenrat
Konflikte verstehen und Persönlichkeiten stärken
Unter Mitarbeit von Barbara Wenders
Pädagogische Einsichten: Praxis und Wissenschaft im Dialog, Band 6
166 Seiten. kart.
16,90 € (D), 17,40 € (A)
ISBN 978-3-8474-3159-6
Auch als eBook: 978-3-8474-1865-8
Stellen Sie sich vor, Kinder lösen Konflikte und entfalten ihr volles Potenzial – und das schon im Klassenrat! Das Buch zeigt, wie Kinder existenzielle Themen bearbeiten, Peer-Konflikte meistern und sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln. Basierend auf der innovativen Methode des Problemklassenrats der Schule Berg Fidel – Geist in Münster, verbindet es praxisnahe Anleitungen mit wissenschaftlichen und historischen Einblicken. Es beleuchtet, wie fundierte Methoden den Klassenraum in einen Raum der persönlichen Entwicklung verwandeln. Mit diesem Ansatz eröffnet sich ein Schulalltag, der Kinder ganzheitlich stärkt und das Gemeinschaftsgefühl nachhaltig fördert.
Der Autor:
Dr. Reinhard Stähling, seit 1982 Lehrer im Schuldienst.
Er hat eine Zusatzausbildung zum Individualpsychologischen Berater. Seit 1992 arbeitete er in der Grundschule Berg Fidel in Münster als Klassenlehrer und stellvertretender Schulleiter. 2002 wurde er Schulleiter dieser Schule im sozialen Brennpunkt. 2014 erweiterte sich die Grundschule zur Primus-Schule Berg Fidel – Geist (Jahrgänge 1–10), deren Schulleiter er bis zur Pensionierung 2022 war. 40 Jahre lang hat er in seinen Klassen die Problemgespräche im Klassenrat geleitet. Zusammen mit seiner Kollegin Barbara Wenders verfasste er viele Bücher auf der Basis gemeinsamer Unterrichtserfahrungen
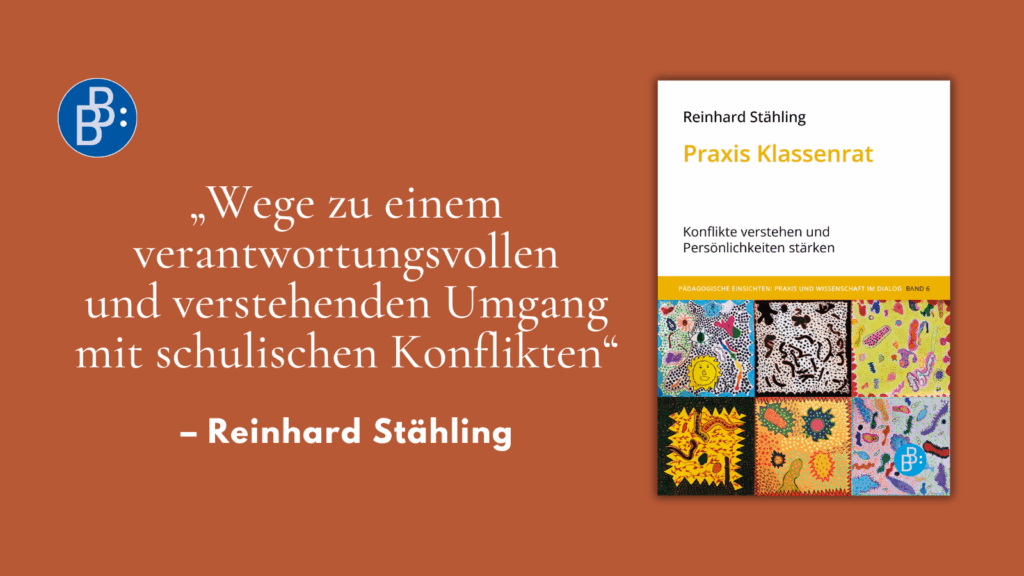
Interview zum Buch mit dem Autor:
https://budrich.de/news/praxis-klassenrat-interview
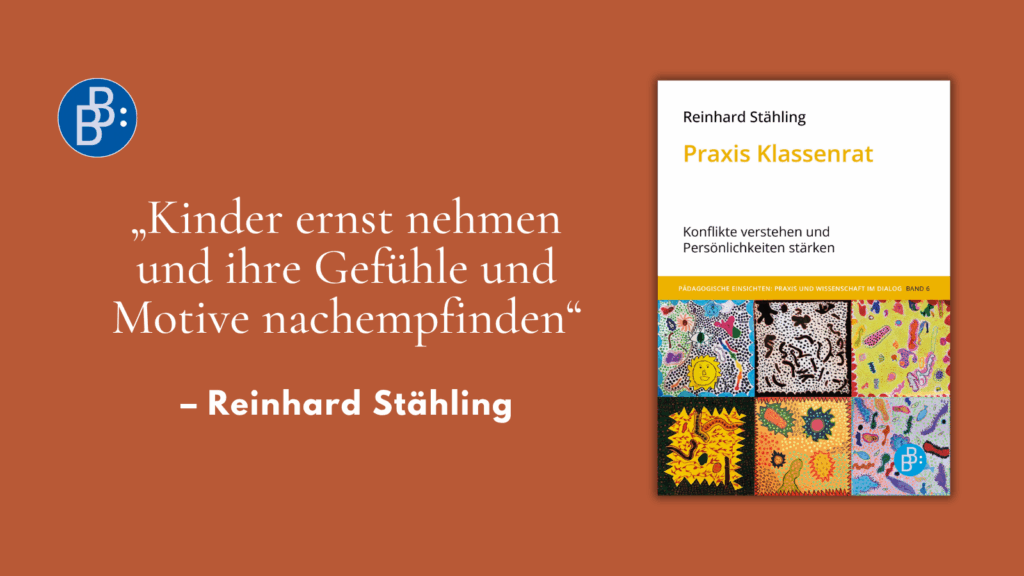
Leseprobe aus dem Buch „Praxis Klassenrat”:
https://budrich.de/news/praxis-klassenrat-leseprobe
Materialien zum Buch „Praxis Klassenrat“ (2025)
1. Gefühlskarten mit Gesichtern
2. Literaturliste, ausführlich
3. Fortbildungen Klassenrat, auch Arbeitsgruppe Stähling am 31.10.2025 am Alfred-Adler-Institut Delmenhorst
Druckvorlage Gefühlskarten
Diese Vorlage darf für den Gebrauch im Schulalltag ausgedruckt werden, ein kommerzieller Nutzen ist nicht erlaubt!
© Inge und Friedel Callies
Literaturliste, ausführlich
Adler, Alfred (1927): Praxis und Theorie der Individualpsychologie. München: Bergmann.
Adorno, Theodor W. (1971): Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
Adorno, Theodor W. (1972): Theorie der Halbbildung. In: Adorno, Theodor W. (Hrsg.): Soziologische Schriften I. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 93-121.
Ansbacher, Heinz / Ansbacher, Rowena (1982): Alfred Adlers Individualpsychologie. München: Reinhardt.
Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese. Tübingen: dgvt-Verlag
Arendt, Hannah (2007): Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. München: Piper.
Bauer. Angela (2013): „Erzählt doch mal vom Klassenrat!“ – Selbstorganisation im Spannungsfeld von Schule und Peerkultur. Halle an der Saale: Universitätsverlag.
Bauer, Angela (2018): Pädagogische Professionalität und Schülermitbestimmung. In: Zeitschrift für Pädagogik,64, H. 5, 680–699.
Bauman, Z. (2009): Gemeinschaften: auf der Suche nach Sicherheit in einer bedrohlichen Welt. Deutsche Erstausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Becker, Ulrike (2023): Auffälliges Verhalten in der Schule. Opladen: Budrich.
Becker, Ulrike / Prengel, Annedore (2010): Kindern institutionell Halt geben – Strukturen für „schwierige Kinder“ in inklusiven Grundschulen. In: Heinzel, Friederike (Hrsg.): Kinder in Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Grundschulverband, S. 184–198.
Bergk, Marion (2002): Streitkultur statt Gewalt. In: Grundschulunterricht 49, 1, S. 9–19.
Betzler, Monika (2019). Autonomie. In: Drerup, Johannes & Schweiger, Gottfried (Hrsg.) Handbuch Philosophie der Kindheit. Stuttgart: Metzler, S. 61-69. https://doi.org/10.1007/978-3-476-04745-8_8
Bildungskommission NRW (1995): Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft. Berlin: Luchterhand.
Blank, Josef (2013): Der demokratiepädagogische Klassenrat. In: Hartnuß, Birger / Hugenroth, Reinhild / Kegel, Thomas (Hrsg.): Schule der Bürgergesellschaft – Bürgerschaftliche Perspektiven für moderne Bildung und gute Schule. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag, 281–289.
Blum, Eva / Hans-Joachim Blum (2023 [2006]): Der Klassenrat. Ziele, Vorteile, Organisation. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
Boban, Ines / Hinz, Andreas (2024): Inklusion und Demokratie – Das eine ohne das andere: weder inklusiv noch demokratisch? In: Bosse, Ingo/ Müller, Kathrin/ Nussbaumer, Daniela (Hrsg.): Internationale und demokratische Perspektiven auf Inklusion und Chancengerechtigkeit. Tagungsbandes der 36. Jahrestagung der Inklusionsforscher:innen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 341–349.
Boer, Heike de (2006). Klassenrat als interaktive Praxis. Wiesbaden: Springer VS.
Boer, Heike de (2010): „Ich war’s nicht!“ Vom Peersein im Klassenrat. In: Schüler 2010. Wissen für Lehrer. Szenen – Gruppen – Peers. Seelze: Friedrich, S. 106–107.
Boer, Heike de (2018). Klassenrat als Ort der Persönlichkeitsbildung? In: Budde, Jürgen/Weuster, Nora (Hrsg.): Erziehung in Schule. Erziehungswissenschaftliche Edition: Persönlichkeitsbildung in Schule. Wiesbaden: Springer VS, S. 163–178.
Bossen, Andrea /Merl, Thorsten /Bauer, Angela (2023): Zur Abstimmung gebracht – Zur Herstellung einer Klassengemeinschaft im Klassenrat. In: ZISU. H. 12/2023, 136–153.
Bossen, Andrea /Merl, Thorsten (2021): Zur Fragilität von Gemeinschaft und Inklusion. In: Zeitschrift für Grundschulforschung 14, 325–340.
Bruder-Bezzel, Almuth (1991): Die Geschichte der Individualpsychologie. Frankfurt / M.: Fischer.
Brüggemann, Christian / Hornberg, Sabine / Jonuz, Elizabeta (2014): Heterogenität und Benachteiligung – die Bildungssituation von Sinti und Roma in Deutschland. In: Hornberg, Sabine (Hrsg.) / Brüggemann, Christian (Hrsg.): Die Bildungssituation von Roma in Europa. Münster: Waxmann, S. 91–120.
Budde, Jürgen (2010): Inszenierte Mitbestimmung!? Soziale und demokratische Kompetenzen im schulischen Alltag. In: Zeitschrift für Pädagogik, 3, 384–402.
Bundesverfassungsgericht (BVerfG). (2019): Beschluss des Ersten Senats vom 19. November 2021–1 BvR 971/2. Bundesnotbremse II (Schulschließungen). http://www.bverfg.de/e/rs20211119_1bvr097121.html [zitiert als: BVerfGE 159, 355–448] [Zugriff: 15.1.2025].
Claussen, Claus (1999): Die Kinderkonferenz. In: Grundschule 31, 10, S. 30–31.
Clifford, A. (2013). Restorative Praktiken mit Kreisgesprächen im Klassenzimmer vermitteln. San Francisco, CA: Center for Restorative Process.
Daschke, Tanja / Pia Hölzel (1977): Klassenrat. In: Freinet-Pädagogik. Hg. v. Christine Koitta. 2. Auflage. Berlin: Basis Verlag, S. 31–43.
Daublebsky, Benita / Lauble, Silvia (2006): Eine Handreichung für die Praxis. Der Klassenrat als Mittel demokratischer Schulentwicklung. Berlin
Delfs, Mytree et al. (Hrsg.) (2023). Diskriminierungskritischer Klassenrat., https://degede.de/mediathek/diskriminierungskritischer-klassenrat [Zugriff: 26.06.2024].
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe) (2009): Klassenrat – Betei- ligung und Mitverantwortung von Anfang an. Internetpublikation: http://bildungsser- ver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/demokratie/ demokratiepaedagogik/ kmk-Tagung_demokratiebildung/pdf/Klassenrat_DeGeDe.pdf [Zugriff: 13.1.2025].
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe) (Hrsg.)(2025): Wir sind Klasse. Klassenratsinitiative für Berlin und Brandenburg. Internetpublikation: https://www.klassenrat.org/material/ [Zugriff: 13.1.2025].
Dewey, John (1916): Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.
Dietrich, Ingrid (1995): Freinet-Pädagogik heute. In: Dietrich, Ingrid (Hrsg.): Handbuch Freinet-Pädagogik. Eine praxisbezogene Einführung. Weinheim: Beltz, S. 13–30.
Dreikurs, Rudolf / Grunwald, Bronia / Pepper, Floy (1987): Lehrer und Schüler lösen Disziplinprobleme. Herausgegeben von H.J Tymister. Weinheim: Beltz.
Edelstein, W. (2010): Ressourcen für die Demokratie. Die Funktionen des Klassenrats in einer demokratischen Schulkultur. In: Aufenanger, Stefan / Hamburger, Franz / Ludwig, Luise / Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Bildung in der Demokratie. Beiträge zum 22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Opladen und Farmington Hills, 65–78.
Edelstein, Wolfgang (2009): Demokratie als Praxis und Demokratie als Wert. In: Edelstein, Wolfgang / Frank, Susanne / Sliwka, Anne (Hrsg.): Praxisbuch Demokratiepädagogik. Sechs Bausteine für die Unterrichtsgestaltung und den Schulalltag. Weinheim und Basel, 7–19.
Edelstein, Wolfgang (2008): Überlegungen zum Klassenrat: Erziehung zu Demokratie und Verantwortung. In: Die Ganztagsschule, 48 (2–3), 93–102.
Falkenstörfer, Sophia (2022a): Für Sorge. In: Menschen, 45, 1, S. 25–30.
Falkenstörfer, Sophia (2022b): Von dem Recht auf Teilhabe zu der Pflicht teilzuhaben – Ein verhängnisvoller Wandel, nicht nur für Menschen mit komplexen Behinderungen. In: Fränkel, Silvia / Grünke, Matthias / Hennemann, Thomas / Hövel, Dennis / Melzer, Conny / Ziemen, Kerstin (Hrsg.): Teilhabe in allen Lebensbereichen? Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 52–57.
Felder, Franziska (2024): Inklusion, demokratische Partizipation und die Aufgabe der Bildung. In: Bosse, Ingo/ Müller, Kathrin/ Nussbaumer, Daniela (Hrsg.): Internationale und demokratische Perspektiven auf Inklusion und Chancengerechtigkeit. Tagungsbandes der 36. Jahrestagung der Inklusionsforscher:innen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 17–29.
Feuser, Georg (2009): Naturalistische Dogmen: Unerziehbarkeit, Unverständlichkeit, Bildungsunfähigkeit. Dederich, Markus; Jantzen, Wolfgang (Hrsg.), Behinderung und Anerkennung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 233–239.
Feuser, Georg (2011a): Entwicklungslogische Didaktik. In Kaiser, Astrid; Schmetz, Ditmar; Wachtel, Peter; Werner, Birgit (Hrsg.), Didaktik und Unterricht. Stuttgart: Kohlhammer, S. 86–100.
Feuser, Georg (2011b): Advokatorische Assistenz. In Erzmann, Tobias; Feuser, Georg (Hrsg.), »Ich fühle mich wie ein Vogel, der aus seinem Nest fliegt.« Menschen mit Behinderungen in der Erwachsenenbildung. Frankfurt a.M.: Peter Lang, S. 203–218.
Feuser, Georg (2013a): Die »Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand« – ein Entwicklung induzierendes Lernen. In ders.; Kutscher, Joachim (Hrsg.), Entwicklung und Lernen. Stuttgart: Kohlhammer, S. 282–293.
Feuser, Georg (2013b): Grundlegende Dimensionen einer LehrerInnen-Bildung für die Realisierung einer inklusionskompetenten Allgemeinen Pädagogik. In ders.; Maschke, Thomas (Hrsg.), Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikation braucht die inklusive Schule?. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 11–66.
Feuser, Georg (2016): Zur endlosen Geschichte der Verweigerung uneingeschränkter Teilhabe an Bildung – durch die Geistigbehindert-Macher und Kolonisatoren. In Fischer, Erhard; Markowetz, Reinhard (Hrsg.), Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 31–73
Feuser, Georg (2017): Inklusion – Das Mögliche, das im Wirklichen noch nicht sichtbar ist. In ders. (Hrsg.), Inklusion – ein leeres Versprechen?. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 183–285.
Feuser, Georg (2018a): Wider die Integration der Inklusion in die Segregation. Zur Grundlegung einer Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik. Berlin: Peter Lang.
Feuser, Georg (2018b): Interview. In Müller, Frank J. (Hrsg.), Blick zurück nach vorn – WegbereiterInnen der Inklusion. Band 2. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 57–145.
Feuser, Georg (2019a): Lernen durch Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand. In Behrendt, Anja; Heyden, Franziska; Häcker, Thomas (Hrsg.), »Das Mögliche, das im Wirklichen (noch) nicht sichtbar ist …« – Planung von Unterricht für heterogene Lerngruppen – im Gespräch mit Georg Feuser. Düren: Shaker, S. 5–30.
Feuser, Georg (2019b): Bildung und Entwicklung. Vortag bei Fachtagung aus Anlass des 80.Geburtstages von Prof. Dr. Reimer Kornmann am 19.10.2019 in Heidelberg.
Feuser, Georg / Stähling, Reinhard (2024): Zur Diskrepanz wissenschaftlicher Studien und schulischer Realität am Beispiel des Paradigmas „anregungsarmer Schulen“ im sozialen Brennpunkt. In: Bosse, Ingo/ Müller, Kathrin/ Nussbaumer, Daniela (Hrsg.): Internationale und demokratische Perspektiven auf Inklusion und Chancengerechtigkeit. Tagungsbandes der 36. Jahrestagung der Inklusionsforscher:innen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 253–260.
Fischer, Jens (1997): Konflikte im Schulalltag. Handlungsstrategien zur gemeinsamen Konfliktbewältigung. In: Praxis Schule 5-10, 8, 1, S. 20–23.
Flissikowski, Simone (2002): Der Klassenrat: Ein praxisorientiertes Konzept für den Umgang mit Konflikten in der Grundschule. In: Itze, Ulrike / Ulonska, Herbert / Bartsch, Christiane (Hrsg.) Problemsituationen in der Grundschule.. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 290–307.
Freinet, Celestin (1979): Die moderne französische Schule. Hg. v. Theodor Rutt. 2. Auflage. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Freinet, Celestin (1981): Praxis der Freinet-Pädagogik. Übersetzung und Bearbeitung von Hans Jörg. Paderborn: Schöning.
Freire, Paulo (1970): Politische Alphabetisierung. In: Lutherische Monatshefte 9, 11, S. 578–583.
Freire, Paulo (1971): Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Stuttgart: Kreuz.
Freire, Paulo (1974): Pädagogik der Solidarität. Für die Entwicklungshilfe im Dialog. Wuppertal: Peter Hammer.
Freire, Paulo (1977): Erziehung als Praxis der Freiheit. Reinbek: rororo.
Freire, Paulo (1981): Der Lehrer ist Politiker und Künstler. Reinbek. Rororo.
Freire, Paulo (2007): Unterdrückung und Befreiung. Hrsg. von Schreiner, Peter u. a. Münster: Waxmann.
Freire, Paulo (2013 [1996]): Pädagogik der Autonomie. Münster: Waxmann.
Friedeburg, Ludwig von (1989): Bildungsreform in Deutschland. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.
Frieß, Jutta (2007): Der Frankfurter Reformschulversuch 1921–1937. Frankfurt / M.: Brandes & Apsel.
Friedrich, Annerose / Kleinert, Irmhild (1997): Der Klassenrat. Demokratie lernt man am besten von Anfang an. In: Praxis Schule 5–10, 8, 5, S. 30–31.
Friedrichs, Birte (2004): Kinder lösen Konflikte. Klassenrat als pädagogisches Ritual. Baltmannsweiler: Schneider.
Friedrichs, Birte (2014; 2023, 3. Aufl.): Praxisbuch Klassenrat. Weinheim: Beltz.
Fuest, Ada (1990): Der “Klassenrat” im Kontext schulischer Lehr-Lernprozesse. In: Tymister, Hans Jürgen (Hrsg.): Individualpsychologische Beratung. München: Reinhardt, S. 48–68.
Fuest, Ada (2008): Und in der Mitte das Kind. Baltmannsweiler: Schneider.
Fuest, Ada (Hrsg.) (2017): Mit Flüchtlingskindern lernen. Baltmannsweiler: Schneider.
Fuest, Ada (2014a): Ermutigung von Kindern. In: Fuest, Ada / John, Friedel / Wenke, Matthias (Hrsg.): Handbuch der individualpsychologischen Beratung in Theorie und Praxis. Münster: Waxmann, S. 361–368.
Fuest, Ada (2014b): Gruppengespräche mit Schülern. In: Fuest, Ada / John, Friedel / Wenke, Matthias (Hrsg.): Handbuch der individualpsychologischen Beratung in Theorie und Praxis. Münster: Waxmann, S. 369–390.
Funk, Lena (2016): Empathie. In: Frey, Dieter (Hrsg.): Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis Zivilcourage – Basiswissen aus Psychologie und Philosophie. 1. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 53–65.
Ghandi, Arun (2018): Wut ist ein Geschenk. Köln: Dumont.
Giroux, Henry A. (2020). On Critical Pedagogy. London: Bloomsbury.
Glänzel, Hartmut (1995): Das Wort geben. In: Dietrich, Ingrid: Handbuch Freinet-Pädagogik. Weinheim: Beltz, S. 31–45.
Göb, Martin (2003): Der Klassenrat: Unbequem, aber klasse! In: Burk, Karlheinz / Speck-Hamdan, Angelika /Wedekind, Hartmut (Hrsg.): Kinder beteiligen – Demokratie lernen? Frankfurt/ M.: Grundschulverband, S. 208–214.
Gordon, Thomas (1977): Lehrer-Schüler-Konferenz. Hamburg: Hoffmann & Campe.
Grabbe, Beate (1992): Der Klassenrat. Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. In: Grundschule, 24, 3, S. 53–55.
Gras, Juliana (2023): Demokratiepädagogik im Kontext von Inklusion: Ein Modell der Schüler*innenpartizipation im Klassenrat in inklusiven Settings. Wiesbaden: Springer.
Gras, Juliana (2024): Inklusion und Exklusion und deren Legitimation in demokratiepädagogischen Formaten am Beispiel des Klassenrats. In: Bosse, Ingo/ Müller, Kathrin/ Nussbaumer, Daniela (Hrsg.): Internationale und demokratische Perspektiven auf Inklusion und Chancengerechtigkeit. Tagungsbandes der 36. Jahrestagung der Inklusionsforscher:innen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 350–356.
Gras, Juliana (2025): Zum Partizipationsermöglichungsdilemma, begrenzter Partizipation und der Forderung einer Reflexiven Demokratiepädagogik. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 28, S. 29–54. https://doi.org/10.1007/s11618-024-01263-2 [Zugriff 30.07.2025].
Gregori, Nina (2019): Lehrpersonenhandeln im Klassenrat. Bern: Lang.
Grüning, Miriam/Martschinke, Sabine/Häbig, Julia/Ertl, Sonja (Hrsg.)(2022): Mitbestimmung von Kindern. Grundlagen für Unterricht, Schule und Hochschule. Weinheim: Beltz
Hanschmann, Felix (2024). Das neue Recht auf schulische Bildung. In: Die Deutsche Schule, 116, 1, 31–51.
Hehn-Oldiges, Martina (2021): Wege aus Verhaltensfallen. Weinheim: Beltz.
Heinzel, Friederike (2003): Zwischen Kindheit und Schule – Kreisgespräche als Zwischenraum. In: Zeitschrift für Qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 3, 1, 81–104.
Heinzel, Friederike (2004): Kreisgespräche – Versammlungen, die herausfordern. In: Bosse, Dorit (Hrsg.): Unterricht, der Schülerinnen und Schüler herausfordert. Bad Heilbrunn, 101–121.
Heinzel, Friederike (2016): Der Morgenkreis. Klassenöffentlicher Unterricht zwischen schulischen und peerkulturellen Herausforderungen. Opladen: Budrich
Heisterkamp, Günter (2010): Zur Freude in der analytischen Kinder- und Jugendpsychotherapie. In: Z. f. Individualpsychologie 35, 4, S. 392–414.
Heisterkamp, Günter (2013): Lebensbewegung und Mit-Bewegung. In: Z. f. Individualpsycholie 38, 1, S. 55–72.
Helbig, Marcel (2023): Die Kluft zwischen Gymnasium und nicht gymnasialen Schulformen. In: Die Deutsche Schule, 115, 4, S. 333–344.
Held, Peter 1997: Die Kummerlöser. In: Pädagogik, 49, 10, S. 16–21.
Hentig, Hartmut von (1993): Die Schule neu denken. München: Hanser.
Herzog, Dagmar (2024). Eugenische Phantasmen. Frankfurt: Suhrkamp.
Hiller, Christoph (2015): Multireligiöse Schulfeiern. Universitäts- und Landesbibliothek Münster. MV-Wissenschaft.
Homepage derklassenrat.de (2021) mit Mitmach-Set zum Klassenrat www.derklassenrat.de
Hooks, Bell (2020): Die Bedeutung von Klasse. Münster: Unrast.
Hooks, Bell (2023): Die Welt verändern lernen. Bildung als Praxis der Freiheit. Münster. Unrast.
Hövel, Walter (1995): Demokratie im Klassenraum. Die Rechte der Kinder und der Klassenrat. In: Dietrich, Ingrid (Hrsg.): Handbuch Freinet-Pädagogik. Weinheim: Beltz, S. 46–72.
Jantzen, Wolfgang (2008): Eine Schule für alle – nicht ohne umfassende Integration behinderter Kinder! In: Ziemen, Kerstin: Reflexive Didaktik. Oberhausen: Athena, S. 15–33.
Kaiser, Astrid (2007): Menschenbildung in Katastrophenzeiten. Baltmannsweiler: Schneider.
Kaiser, Astrid (2011): Schlüsselprobleme. In: Kaiser, Astrid / Schmetz, Ditmar / Wachtel, Peter/ Werner, Birgit (Hrsg.): Didaktik und Unterricht. Stuttgart: Kohlhammer, S.157–166.
Kaiser, Astrid (2014): Praxisbuch handelnder Sachunterricht. Band 4. Baltmannsweiler: Schneider.
Kaiser, Astrid / Lüschen, Iris (2014): Das Miteinander lernen. Frühe politisch-soziale Bildungsprozesse. Baltmannsweiler: Schneider.
Kaiser, Astrid / Pfeiffer, Silke (2007): Grundschulpädagogik in Modulen. Baltmannsweiler: Schneider.
Kaiser, Astrid / Seitz, Simone (2017): Inklusiver Sachunterricht. Theorie und Praxis. Baltmannsweiler: Schneider.
Kamp, Martin (2006 [1995]): Kinderrepubliken (2. Aufl.). Mainz: Eigenverlag.
Karaboğa, Betül (2017): Inklusiv in jeder Hinsicht. Islamischer Religionsunterricht an der Primus-Schule. In: Kirche und Schule 44, 182, S. 28–30.
Keim, Wolfgang / Schwerdt, Ulrich (Hrsg.) (2013): Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland. Frankfurt / M.: Lang.
Keim, Wolfgang / Schwerdt, Ulrich /Reh, Sabine (2016): Reformpädagogik und Reformpädagogik-Rezeption in neuer Sicht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Khan, Ulrike (2020). Klassenrat auf den Punkt gebracht – Material für Pädagog*innen. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V.. https://degede.de/wp-content/uploads/2020/11/kr-paxxdagog-a5-2020-web.pdf [Zugriff 03.07.2024].
Kindlinger, Marcus / Hahn-Laudenberg, Katrin (2024). Critical Incidents im sozialwissenschaftlichen Fachunterricht. In: Gronostay, Dorothee /Manzel, Sabine /Hahn-Laudenberg, Katrin / Teuwsen, Jutta (Hrsg.): Professionelle Unterrichtswahrnehmung im sozialwissenschaftlichen Fachunterricht. London: Springer Natur, S. 87–107. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41829-8_5 [Zugriff 11.5.2025].
Kiper, Hanna (1997): Selbst- und Mitbestimmung in der Schule: Das Beispiel Klassenrat. Baltmannsweiler: Schneider.
Kiper, Hanna (1999): Kinder üben den qualifizierten Umgang miteinander. die Arbeit im Klassenrat. In: Grundschule, 31, 11, S. 24–26.
Kiper, Hanna (2003): Mitbestimmen lernen im und durch den Klassenrat. In: Palentien, Christian / Hurrelmann, Klaus (Hrsg): Schülerdemokratie – Mitbestimmung in der Schule. München: Luchterhand, S. 192-210.
Kiper, Hanna (2007): Der Klassenrat. Über Deutungen und Fehldeutungen seines Charakters und der stattfindenden Lernprozesse. In: PÄD Forum: unterrichten, erziehen, 35, 4, 238–243.
Kiper, Hanna / Wolfgang Mischke (2008): Selbstreguliertes Lernen – Kooperation – Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule. Stuttgart: Kohlhammer.
Klafki, Wolfgang (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
Kock, Renate (2006): Celestin Freinet: Kindheit und Utopie. Bad Heilbrunn: Kinkhardt.
Kohler, Judith / Vethacke, Maj / Sodji, Ivo (2024): Restorative Schule: Gemeinschaft und Verantwortungsübernahme stärken. Berlin: Institut für Restorative Praktiken.
Kovermann, Brigitta (2002): Der Klassenrat: Demokratie mit Jugendlichen im Schulalltag vorbereiten. In: Hansen-Schaberg, Inge / Schonig Bruno: Freinet-Pädagogik. Baltmannsweiler: Schneider, S. 249–279.
Krappmann, Lothar / Kerber-Ganse, Waltraud / Prengel, Annedore / Schmitt, Hanno (2013): Die Sehnsucht nach Anerkennung – Kinderrechte in Geschichte und Gegenwart. Reckahn: Rochow-Museum.
Kropp, Ulrike (2005): Klassenrat und Kinderparlament. In: Christiani, Reinhold (Hrsg.): Jahrgangsübergreifend unterrichten. Berlin: Cornelsen, S. 84–87.
Korczak, Janusz (1967): Wie man ein Kind lieben soll. Göttingen: Vandenhoeck.
Korczak, Janusz (1996-2010): Sämtliche Werke (SW 16 Bd.). Hrsg. von Beiner, Friedhelm / Dauzenroth, Erich. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Krall, Hannes (1999): Eine Schülerin zwischen Aggression und Teilnahmslosigkeit. In: Journal für Schulentwicklung, 4, S. 68–79.
Laun, Roland (1982): Freinet – 50 Jahre danach. Heidelberg: edition meichsner & schmidt.
Leser, Christoph (2011): Demokratie-Lernen durch Partizipation? Opladen: Budrich.
Link, Jörg-W. (2023). Gelingensbedingungen von Schulreform. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Lötscher, Alexander (2015): Der Klassenrat – Tugenderziehung im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Bindung. In: Kübler, Daniel /Dlabac, Oliver (Hrsg.): Demokratie in der Gemeinde: Herausforderungen und mögliche Reformen. Zürich: Schultheis, S. 217–242.
Ludwig, Harald (1993): Entstehung und Entwicklung der modernen Ganztagsschule in Deutschland. Köln: Böhlau.
Makarenko, Anton Semjonowitsch (1960): Der Weg ins Leben. Ein pädagogisches Poem. Berlin: Aufbau-Verlag.
McLaren, Peter (2000): Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution. Lanham: Rowman & Littlefield.
McLaren, Peter (2015): Pedagogy of Insurrection. New York: Lang.
Merl, Thorsten (2019): un/genügend fähig. Zur Herstellung von Differenz im
Unterricht inklusiver Schulklassen. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
Merl, Thorsten, Bauer, Angela & Bossen, Andrea (2023): Klassenrat – nachhaltige Gemeinschaftsbildung? In Michael Haider, Richard Böhme, Susanne Gebauer, Christian Gößinger, Meike Munser-Kiefer & Astrid Rank (Hrsg.), Nachhaltige Bildung in der Grundschule (S. 313–318). Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 313-318. doi.org/10.35468/6035-44, open access PDF.
Meyer, Meinert (1999): Problemlösendes Lernen in der Pädagogik John Deweys. In: Pädagogik, 51, 10, S. 29–32.
Neidhardt, Ursula (2007): Auf dem Weg zur demokratischen Schule. Frankfurt am Main: Lang.
Oser, Fritz (1988): Die gerechte Gemeinschaft und die Demokratisierung der Schulwelt: Der Kohlberg-Ansatz, eine Herausforderung für die Erziehung. In: Vierteljahreszeitschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 1. S. 59–79.
Pehnke, Andreas (2002a): Reformpädagogik aus Schülersicht. Dokumente eines spektakulären Chemnitzer Schulversuchs der Weimarer Republik. Baltmannsweiler: Schneider.
Pehnke, Andreas (2002b): „Ich gehöre in die Partei des Kindes!“ Der Chemnitzer Sozial- und Reformpädagoge Fritz Müller (1887-1968): In Diktaturen ausgegrenzt – in Demokratien vergessen und wiederentdeckt. Beucha: Sax-Verlag, 2. Aufl.
Peschel, Falko (2002): Offener Unterricht. Baltmannsweiler: Schneider.
Peschel, Falko (2008): Ich lerne, was ich will! – Wenn Schüler maßgeblichen Anteil an ihren Lernkulturen haben. In: Rihm, Thomas (Hrsg.): Teilhaben an Schule. Zu den Chancen wirksamer Einflussnahme auf Schulentwicklung. Wiesbaden: Springer, S. 53–63.
Pestalozzi, Johann Heinrich (1799): Sittliches Gefühl. In: Flitner, Wilhelm (1953): Die Erziehung. Bremen: Schünemann, S. 197–219.
Pestalozzi, Johann Heinrich (1799) (1982): Pestalozzi über seine Anstalt in Stans. Weinheim: Beltz.
Pollert, Manfred (1986): Die Freiräume nutzen. Gütersloh: Flöttmann.
Pollert, Manfred (2002): Lernen und leben im 1. Schuljahr. Berlin: Cornelsen.
Pollert, Manfred (2006): Miteinander und voneinander lernen. Gütersloh: Flöttmann.
Post-Lange, Eva (2000): Klassenrat: Ich fand gut, dass … . In: Unterrichten, erziehen, 19, 2, S. 97–99.
Poscher, Ralf; Langer, Thomas (2009): Verbindliche Orientierung. Das Recht auf Bildung im Völkerrecht. Erziehung und Wissenschaft, 3, S. 19–21.
Prengel, Annedore (2014a): Halt gebende pädagogische Beziehung in der inklusiven Grundschule. In: Peters, Susanne / Widmer-Rockstroh, Ulla (Hrsg.): Gemeinsam unterwegs zur inklusiven Schule. Frankfurt / M.: Grundschulverband, S. 64–72.
Prengel, Annedore (2014b): Introspektion und Empathie in pädagogischer Ausbildung, Fortbildung und Forschung – Zur Arbeit mit szenischen Narrationen und Feldvignetten. In: Gerspach, Manfred / Eggert -Schmidt Noerr, Annelinde / Naumann, Thilo / Niederreiter, Lisa (Hrsg.): Psychoanalyse lehren und lernen an der Hochschule. Stuttgart: Kohlhammer, S. 219–246.
Prengel, Annedore (2015): Inklusive Schulen als „Caring Communities“. In: Braches-Cyrek, Rita / Mangione, Cosimo / Penczek, Anke / Fischer, Carina / Rüb, Eva-Maria (Hrsg.): Herausforderung Inklusion. Bamberg: University Press, S. 81–97.
Prengel, Annedore (2018a): Pädagogik der Vielfalt. Inklusive Strömungen in der Sphäre spätmoderner Bildung. In: Müller, Frank J. (Hrsg.): Blick zurück nach vorn – WegbereiterInnen der Inklusion. Bd. 2. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 33–56.
Prengel, Annedore (2018b): Interview. In: Müller, Frank J. (Hrsg.): Blick zurück nach vorn – WegbereiterInnen der Inklusion. Bd.2. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 9-31.
Prengel, Annedore (2019 [1993]): Pädagogik der Vielfalt (4. ergänzte Aufl.). Wiesbaden. Springer.
Prengel, Annedore (2019 [2013]): Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz (2. Aufl.). Opladen: Budrich.
Prengel, Annedore (2020): Ethische Pädagogik. Weinheim: Beltz.
Prengel, Annedore (2022): Schulen inklusiv gestalten. Opladen: Budrich.
Prengel, Annedore / Maywald, Jörg (2020): Regelbüchlein für große und kleine Kinder mit pädagogischer Handreichung. Reckahn: Rochow-Edition. http://www.paedagogische-beziehungen.eu/regelbuechlein [Zugriff 11.5.2025].
Prengel, Annedore / Tellisch, Christin / Wohne, Anne (2016): Anerkennung im Fachunterricht. In: Pädagogik, 68, 5, S. 10–13.
Purmann, Ernst (2001): Morgenkreis und Schulanfang. Das Beispiel der altersgemischten Eingangsstufe in der Schule Vollmarshausen. Kassel: Universitypress. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pedocs.de/volltexte/2009/1681/pdf/Purmann_Ernst_Morgenkreis_D.pdf [Zugriff 03.07.2024].
Ramseger, Jörg (1975): Gegenschulen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Rattner, Josef / Danzer, Gerhard (2010): Pädagogik und Psychoanalyse. Würzburg. Königshausen & Neumann.
Reich, Kersten (2014): Inklusive Didaktik. Weinheim: Beltz.
Reich, Kersten (2017): Inklusive Didaktik in der Praxis. Weinheim: Beltz.
Richter, Horst-Eberhard (1998): Lernziel Solidarität. Giessen: Psychosozial.
Richter, Sophia (2023): Unterrichtsstörungen und Konflikte im schulischen Feld. Opladen: Budrich.
Rosenberg, Marschall (2016). Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens (12. Auflage). Paderborn: Junfermann Verlag.
Röken, Gernod (2011): Demokratie-Lernen und demokratisch-partizipative Schulentwicklung als Aufgabe für Schule und Schulaufsicht. Münster: MV Wissenschaft.
Rüedi, Jürg (2011): Wie viel und welche Disziplin braucht die Schule? Bern: Huber.
Rüedi, Jürg (2012): Ein adlerianischer Ansatz der Erziehung. In: Zeitschrift für Individualpsychologie 37, 1, S. 78–89.
Rühle-Gerstel, Alice (1980): Der Weg zum Wir. Versuch einer Verbindung von Marxismus und Individualpsychologie. München: Reinhardt.
Schäfer, Christa (20239: Online-Kurs zum Klassenrat KlaRa-to-go www.christaschaefer.de/produkt/klara-to-go
Schneider-Bertan, Katarina (2024): Kritische Pädagogik im 21. Jahrhundert. Zur Aktualität von Henry A. Giroux‘ „Critcal Pedagogy‘. Bielefeld: transcript.
Schubarth, Wilfried / Bilz, Ludwig / Wachs, Sebastian (2019): Gewalt und Mobbing – auch eine Folge unterlassener Hilfeleistung? Ergebnisse einer Studie zum Lehrerhandeln bei Gewalt und Mobbing. Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. https://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/uploads/2019/03/ SchubarthEtAl2019_GewaltMobbingLehrerhandeln.pdf [Zugriff: 5.4.2025].
Schwert, Ulrich (2013): Heilpädagogik. In: Keim, Wolfgang / Schwerdt, Ulrich (Hrsg.): Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland. Frankfurt / M.: Lang, Bd. 2, S. 801–834.
Seidel, Ulrich (2014): Übertragung und Gegenübertragung. In: Fuest, Ada / John, Friedel / Wenke, Matthias (Hrsg.): Handbuch der individualpsychologischen Beratung in Theorie und Praxis. Münster: Waxmann, S. 248–261.
Spiel, Oskar (1947): Am Schaltbrett der Erziehung. Wien. Jugend und Volk.
Spiess, Reinhard (1993): Klassenrat. Ein fruchtbarer Unterrichtsersatz? In: Pädagogik, 45, 12, S. 26–28.
Stähling, Reinhard (1995): Teamarbeit im Ganztagszweig. In Burk, K. (Hrsg.), Teamarbeit in der Grundschule (S. 76–81). Frankfurt/M.: Arbeitskreis Grundschule.
Stähling, Reinhard (1998): Beanspruchungen im Lehrerberuf. Münster: Waxmann.
Stähling, R. (2002a). Klassenrat oder das Recht des Kindes auf Achtung.
Stähling, Reinhard (2000): Unterrichtsqualität und Disziplin. In: Grundschule, 32, 2, S. 20–22.
Stähling, Reinhard (2002a): Unter westfälischen Eichen. Historischer Roman zur Reformpädagogik im Jahre 1930. Kelkheim: Ilma.
Stähling, Reinhard (2002b): „Ein wie feines Modell im Kleinen” – Über Merkwürdigkeiten beim Schulwechsel nach Klasse 4. In: Die Deutsche Schule, 94, 1, S. 61–66.
Stähling, Reinhard (2002c): “Für das Leben lernen” – Reformpädagogik als Antwort auf PISA. In: Die Deutsche Schule, 94, 3, S.295-299.
Stähling, Reinhard (2002d): „Wir sind ständig auf Klassenfahrt” – Ein übertragbares Modell ganztägiger Erziehung in der Grundschule. In: neue deutsche schule, 54, 9, S. 22-23
Stähling, Reinhard (2003a): Der Klassenrat – eine Fortführung reformpädagogischer Praxis. In Burk, Karlheinz / Speck-Hamdan, Angelika / Wedekind, Hartmut (Hrsg.): Kinder beteiligen – Demokratie lernen? Frankfurt/M.: Arbeitskreis Grundschule, S. 197–207.
Stähling, Reinhard (2003b): Viertklässler beobachten Fünftklässler – Übergang zu weiterführenden Schulen. Grundschule, 35, 4, S. 57–58.
Stähling, Reinhard (2004a): Multiprofessionelle Teams in altersgemischten Klassen. Ein Konzept für integrativen Unterricht. Die Deutsche Schule, 96, 1, 45–55.
Stähling, Reinhard (2004b): Schulqualität oder: Lob des Fehlers. In: Grundschulverband-aktuell, 88, 4, S. 7–10
Stähling, Reinhard (2005a): Der aufhaltsame Abstieg des „schwachen“ Schülers in Deutschland. Bildungsbenachteiligung im Schnittpunkt von Schule und Jugendhilfe. In: Die Deutsche Schule, 97, 1, S. 67-77
Stähling, Reinhard (2005b): Die Klasse führt sich selbst. In: Grundschule, 37, 2, S. 30–33
Stähling, Reinhard (2005c): Teamarbeit inklusive. In: Christiani, Reinhold (Hrsg.): Jahrgangsübergreifend unterrichten. Berlin: Cornelsen, S. 48–53
Stähling, Reinhard (2005d): Qualitätsentwicklung statt Vergleichsarbeiten. Zu einem unfruchtbaren Verhältnis von Forschung und Schule. In: Die Deutsche Schule, 97, 2, S. 211–221
Stähling, Reinhard (2005e): Gesammelte Fragen zu Vergleichsarbeiten. In: Grundschule aktuell, 90, 2, S. 12–13
Stähling, Reinhard (2005f): Klassenrat – sieben Schritte gegen Gewalt. In: Humane Schule, 31, 2, S. 10–11
Stähling, Reinhard (2006): Ganztägige Erziehung mit multiprofessionellen Teams in altersgemischten Klassen. In: Burk, Karlheinz / Deckert-Peaceman (Hrsg.): Auf dem Weg zur Ganztagsgrundschule. Frankfurt/M.: Arbeitskreis Grundschule, S. 249–259
Stähling, Reinhard (2007a): An den Kindern kann es nicht liegen. – Über die Aussonderung der Armen in Deutschland. In: Grundschule aktuell, 97, S. 11–13
Stähling, Reinhard (2007b): Kinderinteressen – Schulinteressen: ein Balanceakt. In: Christiani, Reinhold / Metzger, Klaus (Hrsg.): Fundgrube Klassenführung. Berlin: Cornelsen, S. 126-129
Stähling, Reinhard (2007c): Sieben Schritte auf dem Weg zum Klassenrat. In: Christiani, Reinhold / Metzger, Klaus (Hrsg.): Fundgrube Klassenführung. Berlin: Cornelsen, S. 129–131
Stähling, Reinhard (2007d): Rezension zu: Astrid Kaiser 2007: Menschenbildung in Katastrophenzeiten. Baltmannsweiler: Schneider. In: Die Deutsche Schule, 99, 2007,4, S. 504-505
Stähling, Reinhard (2008a): Die Grundschule Berg Fidel auf dem Weg zu einer Schule für alle. In: Stadt Münster: Gesund aufwachsen in Münster. Dokumentation der Stadtteilfachtagung im Oktober 2007. Veröffentlichung des Gesundheitsamts
Stähling, Reinhard (2008b): Ein überflüssiges (?) Gedankenexperiment. In: Grundschule aktuell, 103, S. 11
Stähling, Reinhard (2008c): Je homogener, desto … – Inklusive Schulpraxis im sozialen Brennpunkt. In: Grundschule, 40, 2008, 11, S. 48–50
Stähling, Reinhard (2008d): Rezension zu: Astrid Kaiser 2006: Praxisbuch interkultureller Sachunterricht. Baltmannsweiler: Schneider. In: Grundschule, 40, 1, S. 60-61
Stähling, Reinhard (2009a): Alle gleich – alle anders. Berg Fidel: Gründe und Voraussetzungen für die Umgestaltung eines Schulkonzepts. In: Grundschule, 41, 2009, 1, S. 22–25
Stähling, Reinhard (2009b): „Alle gleich – alle anders!“ – Anliegen einer inklusiven Pädagogik. In: Sternberg, Thomas / Meier-Hamidi (Hrsg.): Einwanderungsland Deutschland. Münster: Dialogverlag, S. 89–95
Stähling, Reinhard (2009c): Ungehorsam im Schuldienst – Schritte zur Inklusiven Schule. In: Grundschulzeitschrift, 23, 12, S. 26
Stähling, Reinhard (2010a): Interkulturelle Bildung. In Kaiser, Astrid / Schmetz, Ditmar / Wachtel, Peter / Werner, Birgit (Hrsg.): Bildung und Erziehung. Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Band 3. Stuttgart: Kohlhammer, S. 217–222.
Stähling, Reinhard (2010b): Das Ende des Sitzenbleibens – Kindern „eine Stimme geben“ an der Grundschule Berg Fidel in Münster. In: Beutel, Silvia-Iris / Beutel, Wolfgang: Beteiligt oder bewertet? Leistungsbeurteilung und Demokratiepädagogik. Schwalbach: Wochenschau Verlag, S. 243–247
Stähling, Reinhard (2010c): Grundschule ohne Ausgrenzung. Das Beispiel der Grundschule Berg Fidel Münster. In: Bartnitzky, Horst / Hecker, Ulrich (Hrsg.): Allen Kindern gerecht werden – Aufgaben und Wege. Frankfurt/M.: Grundschulverband, S. 121–131
Stähling, Reinhard (2010d): Sein eigener Chef werden: Schüler bestimmen ihre Pausen selbst. In: Bartnitzky, Horst / Hecker, Ulrich (Hrsg.): Allen Kindern gerecht werden – Aufgaben und Wege. Frankfurt/M.: Grundschulverband, S. 187–190
Stähling, Reinhard (2010e): Wer das Herz hat … – Zur Bedeutung des Ungehorsams für die Schulentwicklung. In: Grundschule, 42, 2010, 7/8, S. 48–50
Stähling, Reinhard (2010f): Gemeinschaftsgrundschule Berg Fidel, Münster – Schule im sozialen Brennpunkt – auf dem Weg zur inklusiven Teamschule. In: Schneider, Lucia (Hrsg.): Gelingende Schulen. Gemeinsamer Unterricht kann gelingen. Schulen auf dem Weg zur Inklusion. Baltmannsweiler: Schneider, S. 59-75
Stähling, Reinhard (2010g): Altersmischung und Inklusion – Beobachtungen in der Praxis. In: Gemeinsam leben. Zeitschrift für integrative Erziehung, 18, 2010, 4, S. 243–252
Stähling, Reinhard (2011 [2006]): »Du gehörst zu uns« – Inklusive Grundschule. Ein Praxisbuch für den Umbau der Schule (4. erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider.
Stähling, Reinhard (2011): Die deutsche Schule be-hindert Lernen – Zur Diskriminierung der Schüler aus benachteiligten Lebenslagen durch das selektive Bildungswesen. In: Gemeinsam leben 19, 3, S. 139-145
Stähling, Reinhard (2013a): Inklusion als Kernprogramm einer „Schule für alle“. Eine Grundschule wird zu einer Schule von 1-13. In: Pädagogik 65, 2013, 9, S. 31–33
Stähling, Reinhard (2013b): „Differenzieren lässt sich lernen“ – Wie die Grundschule Berg Fidel gelernt hat, mit Heterogenität umzugehen und Aussonderung zu unterlassen. In: Müller, Susanne / Jürgens, Eiko: Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule – eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse. Weinheim: Juventa, S.252-264
Stähling, Reinhard (2013c): „Geschönte Selektion“ oder Inklusion? Konstruktiv-kritische Anfragen aus der Grundschule Berg Fidel in Münster. In: Fischer, Christian (Hrsg.): Schule und Unterricht adaptiv gestalten: Fördermöglichkeiten für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Münster: Waxmann, S. 133–140
Stähling, Reinhard (2013d): Stoffliche Hürden und Inklusion. In: Grundschule aktuell, 122, S. 24-26
Stähling, Reinhard (2013e): Klassenfahrt ohne Ali – können wir das verantworten? In: Erziehung und Wissenschaft 65, 2013, 6, S. 20–22
Stähling, Reinhard (2014a): Mit dem Team zur Inklusion. In: Grundschule 46, 2014, 6, S. 12-13
Stähling, Reinhard (2014b): Barrierefreier Unterricht. In: Peters, Susanne / Widmer-Rockstroh, Ulla (Hrsg.): Gemeinsam unterwegs zur inklusiven Schule. Frankfurt / M.: Grundschulverband 2014, S. 102–109
Stähling, Reinhard (2015): Teamarbeit im Unterricht der Grundschule Berg Fidel (Primus-Schule Münster) – Einblicke in den Alltag auf dem Weg zur Inklusion. In: Fischer, Christian / Veber, Marcel / Fischer-Ontrup, Christiane / Buschmann, Rafael: Umgang mit Vielfalt. Münster: Waxmann 2015, S. 193–200
Stähling, Reinhard (2017a): Geflüchtete Kinder in der Schule – Herausforderungen und Lernchancen. In: Kurschel, Robert (Hrsg.): Menschenrechtsbasierte Bildung. Inklusive und Demokratische Lern- und Erfahrungswelten im Fokus. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 283–297.
Stähling, Reinhard (2017b): “Du gehörst zu uns” – Flüchtlinge bereichern unsere Schulklassen. In: Fuest, Ada (Hrsg.): Mit Flüchtlingskindern lernen. Baltmannsweiler: Schneider, S. 5–31.
Stähling, Reinhard (2017c): Die Primus-Schule Berg Fidel – eine Schule mit einer unvorhersehbaren Entwicklung. In: Reich, Kersten (Hrsg.): Inklusive Didaktik in der Praxis. Beispiele erfolgreicher Schulen. Weinheim: Beltz, S. 75–93.
Stähling, Reinhard (2018a): Stoffliche Hürden und Inklusion. In: Grundschule aktuell, 141, S. 17–19
Stähling, Reinhard (2018b): Lernen ohne Brüche. Erfahrungen aus der PRIMUS-Schule Berg Fidel / Geist. In: Gutzmann, Marion / Lassek, Maresi: Kinder beim Übergang begleiten. Frankfurt / M.: Grundschulverband, S. 231–238
Stähling, Reinhard (2019a): Wieso Schulen ohne Brüche von Jahrgang 1 bis 10? In: Grundschule aktuell, 147, S. 30–33
Stähling, Reinhard (2019b): Was brauchen Kinder? In: Grundschule aktuell, 148, S. 22
Stähling, Reinhard (2021): Macht die Kinder zu Geschwistern. In: Der Freitag, 49 (9.12.2021), S. 13
Stähling, Reinhard (2022): Beitrag der Schüler*innen zur Schulentwicklung im sozialen Brennpunkt. In: Grundschule aktuell, 157, S. 9–13
Stähling, Reinhard (2023a): Das Ruder in die Hand nehmen. In: Anderegg, Nils / Knies, Angelika / Jesacher-Rössler, Livia / Breitschaft, Johannes (Hrsg.), Leadership for Learning – gemeinsam Schulen lernwirksam gestalten. Bern: heb- Verlag, S. 222–232.
Stähling, Reinhard (2023b): Das Paradigma von der ›anregungsarmen‹ Schule im sozialen Brennpunkt. In: Forell, Matthias / Bellenberg, Gabriele / Gerhards, Lukas / Schleenberger, Lena: Schule als Sozialraum im Sozialraum. Münster: Waxmann, S. 123–136.
Stähling, Reinhard (2023c): Lerne, dir eine Pausenzeit zu nehmen! Pädagogik, 75, 9, S. 27–30.
Stähling, Reinhard (2023d): Pädagog:innen-Teams für jede Klasse der gebundenen Ganztagsschule in der Primus-Schule Berg Fidel – Geist Münster. In: Die Ganztagsschule, 63, S. 64–69.
Stähling, Reinhard (2023e): Wie entwickelten sich in jeder Klasse feste Erwachsenen-Teams als Verantwortungsgemeinschaft? Grundschule aktuell, 152, 164, S. 27–28.
Stähling, Reinhard (2023f): Das Paradigma des ›anregungsarmen‹ Milieus in Schulen in herausfordernder Lage. Eine kritische Kommentierung aus Perspektive eines Schulleiters. In: Schuppener, Saskia /Leonhardt, Nico / Kruschel, Robert: Inklusive Schule im Sozialraum. Wiesbaden: Springer, S. 299–312.
Stähling, Reinhard (2023g): Potenziale von Schülerinnen und Schülern im sozialen Brennpunkt. Praxiserfahrungen der PRIMUS-Schule in Münster. In Fischer, Christian / Fischer-Ontrup, Christiane / Käpnick, Friedhelm / Neuber, Nils / Reintjes, Christian (Hrsg.), Potenziale erkennen – Talente entwickeln – Bildung nachhaltig gestalten. Münster: Waxmann, S. 149–157.
Stähling, Reinhard (2023h): Worin unsere Stärke besteht – die Stadtteilschule im sozialen Brennpunkt als „FELS“ in der Brandung, In: Bernikowski, Bernd / Hörmann, Georg / Kaiser, Astrid (Hrsg.): Antinomische Pädagogik und Kommunikative Didaktik. Ein Rück- und Ausblick. Baltmannsweiler: Schneider, S. 127–137
Stähling, Reinhard (2023i): Wie große Veränderungen klein beginnen. Ein Erfahrungsbericht an Beispiel der Primus-Schule Berg Fidel. In: Deutsch differenziert, 18, 1, S. 6–8
Stähling, Reinhard (2023j): Wertschätzende Sprachdidaktik. Mehr als Lesen- und Schreibenlernen. In: Deutsch differenziert, 18, 1, S. 9–11
Stähling, Reinhard (2024a): »Worin unsere Stärke besteht« – Acht bewährte Gelingensbedingungen für eine solidarische und inklusive Schule. In Friebe, Stephan / Thoma, Birgit (Hrsg.): Inklusion und Partizipation gelingen! Neckarbischofsheim: Bildungs-Akademie, S. 53–59.
Stähling, Reinhard (2024b): Elterninteressen und Schulentwicklung in einem Stadtteil mit erschwerten Lebensverhältnissen. Über Sinn und Aufbau altersgemischter Klassen heute – am Beispiel der Schule in Berg Fidel. Sonderpädagogische Förderung heute, 69, 3, S. 308–319.
Stähling, Reinhard (2024c): Schulintern den Umbau über Jahrzehnte organisieren. Schulheft, 49, 195, S. 101–117.
Stähling, R. (2024d). In der Schule Widerstand lernen – Solidarität mit Rom*nja. Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik Nr. 247/248, 63, 3–4, S. 83–95
Stähling, Reinhard (2025): Entwicklungsschritte einer Schule im Brennpunkt. Der praktische Weg zu Solidarität und Inklusion. Gießen: Psychosozial- Verlag.
Stähling, Reinhard (2025): Migrantenfamilien in Not: Die Antwort der Schule und der Beitrag der Kinder zu einer solidarischen Schule – die Entwicklung der PRIMUS-Schule Berg Fidel – Geist Münster. In: Demirel, Molla (Hrsg.): Die Bedeutung multikultureller und mehrsprachiger Bildung in der Migrationsgesellschaft. Münster: Free Pen Verlag, S. 186–204
Stähling, Reinhard / Möwes, Christian (2023): Schonraum oder Klassenraum? Was hilft gegen Schwänzen? Lernende Schule, 26, 101, S. 33–35.
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2010): Schluss mit der Aussonderung – Wege inklusiver Pädagogik am Beispiel der Grundschule Berg Fidel. In: Hanke, Petra / Möwes-Butschko, Gudrun / Hein, Anna Katharina / Berntzen, Detlef / Thieltges, Andree (Hrgs.): Anspruchsvolles Fördern in der Grundschule. Münster: Zentrum für Lehrerbildung Verlag, S. 115-118
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2012a): »Das können wir hier nicht leisten« – Wie Grundschulen doch die Inklusion schaffen können. Ein Praxisbuch zum Umbau des Unterrichts. Baltmannsweiler: Schneider.
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2012b): „Wie ein Sandkorn …“ Zum Inklusionsbegriff und zum Index für Inklusion. Gespräch mit Tony Booth. In: Grundschule 44, 2012, 3, S. 24–25
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2013 [2009]): Ungehorsam im Schuldienst. Der praktische Weg zu einer Schule für alle (4. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider.
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2013): „Er ist nicht da, wenn er gebraucht wird, doch er ist zur Stelle, wenn er sich nützlich machen kann.“ (Korczak) – Unterrichten in der Grundschule Berg Fidel. In: Gemeinsam leben 21, 2013, 3, S. 160–169
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2014): „Hier fliegt keiner raus!“ – Über Freude und Halt in einer inklusiven Schulklasse der Grundschule Berg Fidel. In: Z. f. Individualpsychologie 39, 3, S. 319-337
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2015): Teambuch Inklusion. Ein Praxisbuch für multiprofessionelle Teams. Baltmannsweiler: Schneider.
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2018): Schule ohne Schulversagen. Praxisimpulse aus Grundschule und Sekundarstufe für eine gemeinsame Schule. Baltmannsweiler: Schneider.
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2019a): Ein Tag in der PRIMUS-Schule Berg Fidel / Geist. Einblicke in eine Stammgruppe einer Versuchsschule. In: Wocken, Hans: Die AUCH-Inklusion. Die Idee der Inklusion und die Macht des Systems. Hamburg: Feldhaus, S. 179–198
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2019b): Vertieft lernen dürfen. Langformschule von 1-10 als „Schule ohne Schulversagen“. In: Grundschule aktuell, 146, S. 23-27
Stähling, Reinhard/ Wenders, Barbara (2020): Freies Forschen und Herausforderungen in der PRIMUS-Schule Berg Fidel / Geist Münster. In: Boban, Ines / Hinz, Andreas (Hrsg.): Inklusion und Partizipation in Schule und Gesellschaft. Weinheim: Beltz, S. 245–258
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2021): Worin unsere Stärke besteht. Eine inklusive Modellschule im sozialen Brennpunkt. Gießen: Psychosozial-Verlag
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2024): »Denn wovon sonst, wenn nicht vom Elternhaus, soll Bildung abhängen?« (Klaus Zierer) – Brandgefährliche Thesen eines Pädagogen zur »Ungleichheit«, in SZ vom 14./15.09.2024. Zeitschrift für Inklusion, 19(5), S. 127–141. https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/ view/818
Stähling, Reinhard / Wenders, Barbara (2025): »In die Wiege gelegt«? – Gegen naturalisierende Mythen und Zierers Thesen zur »Ungleichheit«, in SZ vom 14./15.9.2024. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 45, 1, S. 96–103.
Straessle, Bernadette (2021): Klassenrat. Die Basisdemokratie im Schulzimmer.
Konstanz: Hartung-Gorre Verlag
Tetzlaff, Rainer (2023): Der afrikanische Blick. Unerwartete Perspektiven der Integration. Frankfurt / M.: Brandes + Apsel.
Tymister, Hans-Josef (1985): Beratung. In: Brunner, Reinhard; Krausen, Rudolf; Titze, Michael (Hrsg.): Wörterbuch der Individualpsychologie. München: Reinhardt, S. 48-52.
Uhlig, Christa (2013): Fahrten und Lager. In: Keim, Wolfgang / Schwerdt, Ulrich (Hrsg.): Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland. Frankfurt / M.: Lang, Bd. 2, S. 1206–1224.
Ullrich, Heiner (2013): Religiosität / Spiritualität. In: Keim, Wolfgang / Schwerdt, Ulrich (Hrsg.): Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland. Frankfurt / M.: Lang, Bd. 1, S. 499–532.
UN (1999): Erklärung über eine Kultur des Friedens und Aktionsprogramm für eine Kultur des Friedens. Resolution A/RES/53/243 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 13. September 1999. https://www.unesco.de/assets/dokumente/Deutsche_UNESCO-Kommission/ 07_Resolutionen/Erkl%C3%A4rung_%C3%BCber_eine_Kultur_des_Friedens_und_Aktionsprogramm_f%C3%BCr_eine_Kultur_des_Friedens.pdf [Zugriff: 13.5.2025]
UN-BRK (2006 /2009): Artikel 24 UN-BRK. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/datenbanken/datenbank-fuer-menschenrechte-und-behinderung/detail/artikel-24-un-brk [Zugriff: 13.5.2025]
Villa, Richard A. / Thousand, Jacqueline S. (2000): Restructuring for Caring and Effective Education. Baltimore: Brookes, 2. Aufl.
Vygotskij, Lew (2003): Ausgewählte Schriften, Band 1+ 2. Hrsg. von Lompscher, Joachim Köln: Pahl Rugenstein (1987); Berlin: Lehmanns Media.
Vygotskij, Lew (2017): Denken und Sprechen. Hrsg. von Lompscher, Joachim /Rückriem, Georg. Weinheim: Beltz.
Wagenschein, Martin (1968): Verstehen lehren. Genetisch – Sokratisch – Exemplarisch. Weinheim: Beltz.
Wagner, Sandra / Powell, Justin (2002): Zur Entwicklung der Überrepräsentanz von Migrantenjugendlichen an Sonderschulen in der BRD seit 1991. In: Gemeinsam Leben, 10, S. 66–71.
Wapler, Friederike (2021): Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen zwischen Paternalismus, Kindeswohl und Kindeswille – Anmerkungen zu den Reckahner Refle-
xionen aus juristischer Sicht. https://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/uploads/2021/11/Wapler_Kinderrechte_Lizenz.pdf [Zugriff: 5.4.2025].
Wenders, Barbara (2009): Ein Hauch Woodstock täte gut. In: Grundschule 41, S. 30–32.
Wenders, Barbara (2013): Kinder mit herausforderndem Verhalten. In mittendrin e.V. (Hrsg.): Alle mittendrin! Mühlheim: Verlag an der Ruhr, S. 181–188.
Wenders, Barbara (2018a): Der Übergang von der KiTa in die Grundstufe der Primus-Schule. In: Gutzmann, Marion / Lassek, Maresi: Kinder beim Übergang begleiten. Frankfurt / M.: Grundschulverband, S. 129-136.
Wenders, Barbara (2018b): Der Übergang nach Klasse 4. Erfahrungen im traditionellen System und aus der PRIMUS-Schul-Entwicklung. In: Gutzmann, Marion / Lassek, Maresi: Kinder beim Übergang begleiten. Frankfurt / M.: Grundschulverband, S. 137–146.
Wenders, Barbara (2020): Eigene Gefühle mit Gefühlskarten zur Sprache bringen. In: Philosophie und Ethik in der Grundschule, 1, 1, S. 9-11.
Wilker, Karl (1921a): Der Lindenhof. Werden und Wollen. Heilbronn am Neckar.
Wilker, Karl (1921b): Fürsorgeerziehung als Lebensschulung. Ein Aufruf zur Tat. In: Die Lebensschule. Berlin, I, 3.
Wocken, Hans (2017): Demokratie lernen und leben im Klassenrat. In: Ders.: Beim Haus der inklusiven Schule. Hamburg: Feldhaus, S. –-32.
Wocken, Hans (2020): Die Grundschule – eine inklusive Schule. In: Frankfurt / M.: Grundschulverband, S. 237-247.
Wysujack, Vivien (2020): Empirische Forschung zu pädagogischen Beziehungen. Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. https://paedagogische-beziehungen.eu/wp-content/uploads/2020/03/Modul-4_EmpirischeBildungsforschung_VivienWysujack.pdf [Zugriff: 5.4.2025].
Ziemen, Kerstin (2009): Sozialer Tausch. In: Dederich, Markus / Jantzen, Wolfgang (Hrsg.): Behinderung und Anerkennung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 96–104.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Filme über die Schule Berg Fidel
Stähling, Reinhard (1993): Leben und Lernen im Ganztagszweig. Videofilm für Eltern und Mitarbeiter der Grundschule Berg Fidel über das Leben und Lernen im ersten Schuljahr des Ganztagszweigs. Universität Münster. Zentrum für Wissenschaft und Praxis. Abteilung für Audiovisuelle Medien
Stähling, Reinhard (2001): Klassenrat oder das Recht des Kindes auf Achtung. Videofilm für die Lehrerausbildung und -fortbildung und Elternarbeit. Universität Münster. Zentrum für Wissenschaft und Praxis. Abteilung für Audiovisuelle Medien.
Wenders, Hella (2011): Berg Fidel. Dokumentarfilm. W-Film
Wenders, Hella (2017): Schule, Schule – die Zeit nach Berg Fidel. Dokumentarfilm. Augenschein
Wenders, Hella (2021): PERSPEKTIVEN. Dokumentarfilm über Freie Arbeit und Klassenrat. Stuttgart: FriJus
Fortbildungen
Dr. Reinhard Stähling, ehem. Schulleiter der Primus-Schule Berg Fidel – Geist
Kontakt: 01752943162 und ggs-bergfidel@gmx.de
Stähling, Reinhard (2025): Praxis Klassenrat. Konflikte verstehen und Persönlichkeiten stärken
Fortbildung: „Probleme lösen mit dem Klassenrat“
Hier beschreibe ich stichwortartig eine selbsterfahrungsorientierten Fortbildungsreihe, die sowohl praxisorientiert zum Klassenrat anleitet, als auch das Selbstvertrauen zu einem verantwortungsvollen, effektiven und verstehenden Umgang mit schulischen Problemen stärkt. Sie besteht aus mindestens 5 Treffen, die am Ende zu einer selbständigen Weiterarbeit in Gruppen führen soll. Gedacht ist an ein Seminar in ein bis drei Räumen, mit ca. 12 bis 30 Teilnehmer*innen (Lehrkräfte, Pädagog*innen, Eltern, Studierende). Die vierstündige Einstiegssitzung wird in Form eines Ablaufplans exemplarisch erläutert.
Ankündigungstext:
Probleme in der eigenen Schulzeit. – Welche Rolle spielt die Klassengemeinschaft? Was können wir heute machen? – Der Klassenrat als Methode.
Ausgehend von der eigenen Schulzeit und den früheren Erfahrungen mit persönlichen Problemen versuchen wir zu verstehen und heute nachzuempfinden, wie wir uns als Kind selbst fühlten. Wir fühlen uns in uns als Kind ein. Daraufhin erarbeiten wir in der selbsterfahrungsorientierten Fortbildungsgruppe rücksichtsvolle Lösungen, die bei heutigen Problemen in der Schule fruchtbar sein können. Dabei spielt die Klassengemeinschaft eine zentrale Rolle. Der verstehende Klassenrats wird auf diese Weise vorgestellt, simuliert und erprobt. Kollegiale, verstehende Beratung steht im Mittelpunkt.
Teilnehmende (TN): 12-30 Erwachsene, die bereit sind, sich in die eigene Schulzeit zurückzuversetzen und die damaligen Gefühle nachzuempfinden. Alle Berufsgruppen, auch Eltern möglich; bevorzugt Klassenlehrer*innen, die den Klassenrat erproben oder bereits machen. 12- 30 Teilnehmende.
Erstes Treffen in der Schule in Berg Fidel (30 TN, Samstag, 9-13.15 Uhr):
| Zeit Ort | Leiter*in (L) | Teilnehmende (TN) | Medien |
| 9.00 Uhr Aula Sitzkreis | Kennenlernen: Jeden Kommenden fragen, wie er/ sie darauf gekommen ist, sein/ihr Fach zu studieren, bzw. Lehrer*in zu werden. Hervorheben, wer Praxiserfahrungen mitbringt. Überblick über die Fortbildungsreihe und den heutigen Tag. 3 freiwillige Klassenrats-Leiter*innen für die spätere Gruppenarbeit auswählen. | Berichten, dass sie praktische Vorerfahrungen haben als Gruppenleiter*in, FSJ, Erzieher*in, Lehrkraft. | |
| 9.45 Uhr 3 Klassenräume mit vorhandenen Sitzkreisen (Bänkchen) | Rundgang durch Klassen (mit je 2 Räumen). L-Erläuterung: Jede Klasse hat ein klasseneigenes Pädagog*innen-Team. Verantwortung des Teams. Inklusion: Alle Kinder des Stadtteils werden aufgenommen. L: Sitzkreise werden gezeigt für die spätere Gruppenarbeit und Erprobung des Klassenrat | Fragen zur inklusiven und verstehenden Pädagogik in Berg Fidel | |
| 10.15 Uhr Aula Sitzkreis | 1)Probleme auf Zettel 2) Klassenrat–Demonstration mit allen: 2a) Befindlichkeit mit Gesichter-Karten, jede*r legt ein Plättchen zu der eigenen Gefühlskarte, L: Möchte jemand über seine Gefühlslage etwas erzählen? 2b) Besprechung: Freiwillige*r TN trägt sein/ihr Problem vor. L führt das Gespräch nach Regeln (siehe Kap. 2.3) Zuerst spricht, wer das Problem hat. Wer z.B. von einem anderen Kind in der Klasse verletzt wurde und dies ins Klassenratsbuch geschrieben oder gemalt hat, fängt an. Sie oder er spricht, solange sie oder er will und wird von niemandem unterbrochen.Dann spricht der Gegenspieler. Auch sie oder er wird von niemandem unterbrochen.Erst wenn beide Parteien zu Ende geredet haben, ist Zeit für Fragen an die beiden Parteien aus dem Kreis.Gemeinsam wird am Ende nach Lösungen gesucht und gefragt, ob die Parteien mit den Vorschlägen etwas anfangen möchten. Vereinbarungen werden getroffen und im Klassenratsbuch notiert. Gelöste Probleme werden abgehakt, offene Fragen notiert. 3) Auftrag an 3 Gruppen: Klassenrat ausprobieren, L kontrolliert die Gruppengröße. | 1)Jede*r schreibt 2 Probleme auf Zettel aus der eigener Schulzeit (oder aus der Praxis) mit 1 anderen Kind; je Problem 1 Zettel mit eigenem Namen drauf. 2a) Befindlichkeit: Einzelne TN: erzählen zu den Gefühlskarten 2b) Problembesprechung: 1 TN trägt ein eigenes Problem mit einem Gegenspieler von früher vor (Zettel). TN benennt eine*n Freiwillige*n aus dem Kreis, dem/ der er die Rolle des Gegenspielers zuschreibt. Besprechung nach der Regel: TN sagt dem Gegenspieler sein Problem. Der Gegenspieler antwortet (nach eigener Phantasie). Andere TN fragen nach. Lösungen werden gemeinsam beraten. 3)Klassenrat-Erprobung 3 Klassenrat-Leiter*innen (TN) sollen 10er-Gruppe mit in Klassen (einen der drei Sitzkreise) nehmen: 10er- Gruppen bilden sich auf dem Weg zu den 3 Klassenräumen, TN schließen sich den 3 Leiter*innen an. | 1)Farbige Zettel 2a)Gefühlskarten mit Gesichtern (siehe www.reinhard-staehling.de), Legeplättchen |
| 11.00 Uhr Klassenraum Sitzkreis | 4)Selbstständige Gruppenarbeit | 4)Selbstständige Erprobung des Klassenrats in 10er- Gruppen mit eigenen Leiter*innen (TN). 4a) Befindlichkeit 4b) Problembesprechung: Leiter*in (TN) zieht Zettel, wo ein Problem notiert ist. TN besprechen das Problem nach den Regeln. 4c) Selbstständige Reflexion in der Gruppe: Wie geht es den Protagonisten? Wie verhalte ich mich als Leiter*in (TN), wenn ich nach Lösungen gefragt werde? | Problem-Zettel und Gefühlskarten |
| 11.45 Uhr Aula Sitzkreis | 5)Rückmeldung: Beim Eintreffen in die Aula fragt L, wie der Klassenrat den 3 Leiter*innen (TN) gelungen ist. L fragt TN, besonders Protagonisten, wie es ihnen bei der Besprechung ging. L: Probleme offen hören, z.B. wie halte ich mich zurück, um die Gruppe zu aktivieren. | 5) Leiter*innen (TN) der Gruppenberichten, wie ihnen der Klassenrat gelungen ist. Protagonisten erzählen über ihre Gefühle TN geben Rückmeldung an die Gruppenleiter*innen | |
| 12.15 Uhr Aula | 6)Vortrag: Klassenrat, Klassenratsbuch, Dauer. | 6)Fragen der TN | Beamer, Laptop, PPP über Klassenrat |
| 12.45 – 13.15Uhr Aula | 7)Rückblick, was wir mitnehmen, reihum Vereinbarung: TN erproben in ihren eigenen Klassen bzw. Gruppen den Klassenrat | 7)Gefühle und Visionen Pläne für die Zukunft | Gesprächsstein oder anderes |
Fortsetzung der Reihe:
Zweites Treffen (Samstag ca. 4 Stunden, wenige Wochen später):
Auswertung der eigenen Praxiserfahrungen mit Klassenrat
Eingehen auf spezielle Probleme
Simulation von Klassenratssitzungen
Supervision bezüglich der eigenen aktuellen Probleme im Beruf mit Rückblick auf die eigene Schulzeit.
Drittes Treffen (Samstag, ca. 6 Stunden nach einer längeren Pause):
Fortsetzung der Auswertung der eigenen Praxiserfahrungen mit Klassenrat
Supervision bezüglich der eigenen Probleme mit Schüler*innen
Neueinführung:
Kollegiale Fallberatung (Selbstständige Besprechung von Problemen mit Schüler*innen in Kleingruppen (vgl. auch Reich 2014, S. 304ff.)
Exemplarischer Ablauf:
Eine Kollegin trägt ihren Fall vor (z.B. Ali)
- 1. Runde von allen: „Ich als Kollegin fühle / denke…“
- 2. Runde von allen: „Ich als Ali fühle / denke …“
- 3. Runde, Vorschläge zur Lösung: „Ich als Kollegin handle ……“
Ende: Kollegin sagt selbst, was sie nun tun wird; dabei bezieht sie die Möglichkeiten des Klassenrats ein.
Weitere Treffen (mehrmals wochentags ca. 4 Stunden nach Bedarf und Möglichkeiten):
Hospitation in Schulen beim Klassenrat
Auswertung der Hospitationen
Fortsetzungstreffen (Samstag ca. 6 Stunden, nach längerem zeitlichen Abstand):
Erneuter Austausch über die eigenen Erfahrungen
Bildung von selbstständigen Gruppen, die sich zukünftig treffen, um ihre beruflichen Probleme kollegial zu besprechen.
Selbständige Fortsetzung der kollegialen Arbeit in Gruppen.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Arbeitsgruppe Stähling am 31.10.2025 in Delmehorst bei der Jahrestagung der DGIP

